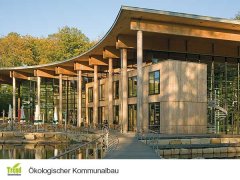Blockheizkraftwerke
Im direktem Zusammenhang mit dem Bau von ökologischen Neubauten- und Gewerbebauten steht der Einsatz von Blockheizkraftwerken. In der Bundesrepublik Deutschland gehen jährlich ca. 50% der erzeugten Energie verloren, der größte Teil hiervon im Sektor der Strom- und Wärmeerzeugung für Privatwohnräume und öffentliche Gebäude wie Schulen, Schwimmbäder und Gewerbebauten etc..
In Kondensationskraftwerken wird die meiste Energie produziert, allerdings kommen nur ca. 34 % der eingesetzten Primärenergie (fossile Brennstoffe) beim Endverbraucher an. Die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme, die restlichen 2/3 der Primärenergie, wird oftmals stark umweltbelastend in die Atmosphäre geleitet. Beim Endverbraucher muss die benötigte Wärmeenergie zusätzlich mit einem Heizkessel bereitgestellt werden.
Um diesen extremen Verlust zu vermeiden ging man zur Kraft-Wärme-Kopplung in Heizkraftwerken, also zur parallelen Erzeugung von Strom und Wärme in einem Prozess, über. Hierbei wird die entstehende Wärme nicht abgeleitet sondern über ein Fernwärmenetz zum Endverbraucher geleitet. Da Heizkraftwerke aber eine enorme Lärmbelastung für die Bevölkerung darstellen werden sie in großer Entfernung zu Wohnsiedlungen errichtet. Somit sind die Wege des Wärmetransports lang und auch hier besteht noch ein Verlust von 6%. Immerhin ist der Nutzungsgrad aber auf 75% erhöht.
Den höchsten Nutzungsgrad, ca. 90% erreicht man mit Blockheizkraftwerken. Diese gekoppelte Form der Strom- und Wärmeerzeugung ist wesentlich leiser durch den Einsatz von Verbrennungsmotoren statt Turbinen, kann also verbrauchernah stattfinden und der hohe Energieverlust durch den langen Wärmetransport entfällt. Die Verbrennungskraftmaschinen können noch ergänzt werden durch zugeordnete Generatoren, Spitzenlastkessel, Speicher und Wärmepumpen. Wärmepumpen können statt Wärme auch Kälte produzieren: in diesem Fall spricht man von Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung.